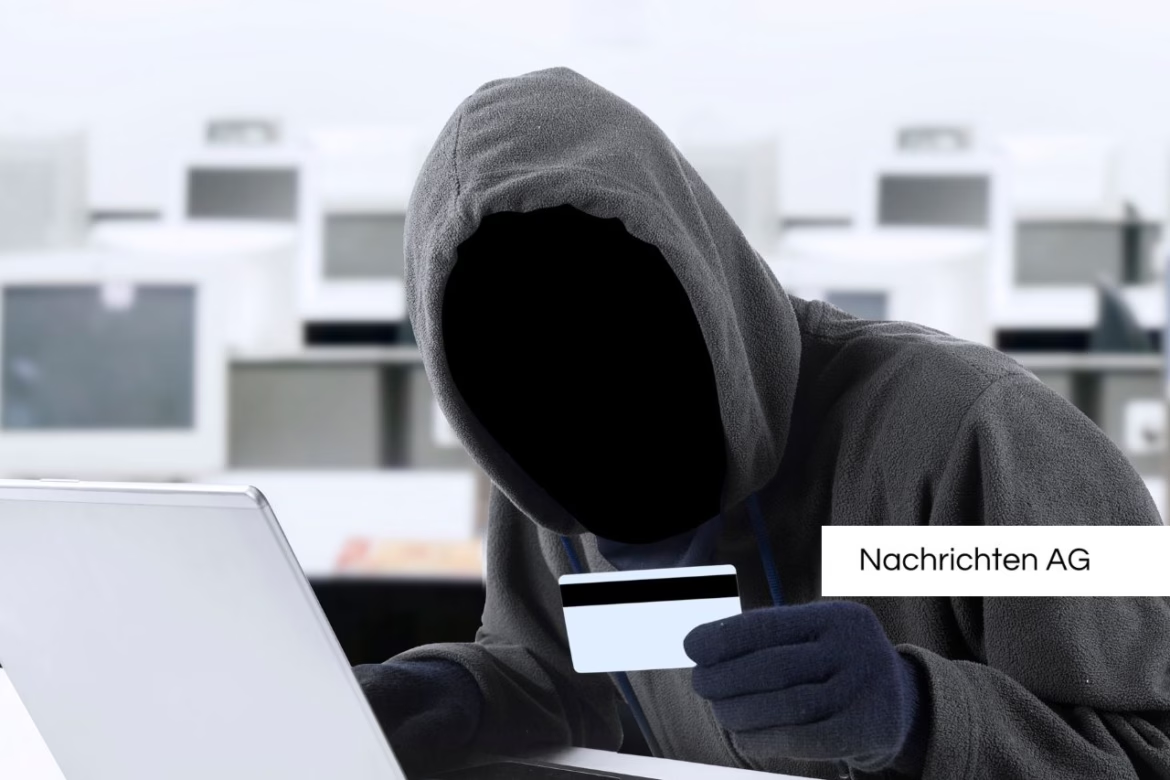
Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen ermittelt aktuell wegen Wirtschaftsbetrugs in Millionenhöhe gegen sechs Personen. Den Beschuldigten wird Subventionsbetrug mit Corona-Finanzhilfen sowie Insolvenzverschleppung vorgeworfen. Laut NDR besteht der Verdacht, dass falsche Angaben in Anträgen für Corona-Hilfen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in den Jahren 2020 und 2021 gemacht wurden.
Die Kredite seien „zweckwidrig verwendet“ worden, wobei die genaue Verwendung des Geldes nicht angegeben wurde. Am vergangenen Donnerstag fanden umfangreiche Durchsuchungen in zwölf Objekten in Niedersachsen, Hamburg und Sachsen-Anhalt statt, worunter Firmenunterlagen und digitale Daten beschlagnahmt wurden. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine 56-jährige Frau sowie ein 40-jähriger Mann, die gemeinsam mit ihren Anträgen geltende Höchstbeträge umgangen haben, um für fünf Unternehmen aus der Speditionsbranche insgesamt rund 3,5 Millionen Euro an Corona-Hilfen zu erhalten.
Subventionsbetrug im Fokus
Besonders auffällig ist, dass die 56-Jährige einen KfW-Kredit für ihre eigene Firma für andere Zwecke herangezogen haben soll, was zu einem geschätzten Schaden von zwei Millionen Euro führte. Neben diesen Vorwürfen gibt es auch den Verdacht auf mutmaßliche Insolvenzverschleppung, da zwei Firmen trotz finanzieller Schwierigkeiten im Jahr 2024 verkauft worden sein sollen. Es wird unterstellt, dass die Geschäftsführung in diesem Fall einen Insolvenzantrag hätte stellen müssen.
Zusätzlich zu den laufenden Ermittlungen gibt es auch in Deutschland insgesamt einen Anstieg an Fällen von Subventionsbetrug, die insbesondere während der Corona-Pandemie auftraten. In diesem Zusammenhang berichtete anwalt.de, dass die Bundesregierung unbürokratische Soforthilfen bereitgestellt hat, um Kleinunternehmer, Freiberufler und Solo-Selbstständige zu unterstützen. Dennoch gab es erste Anzeigen wegen Subventionsbetrugs, die sowohl von Zollämtern als auch von Banken initiiert wurden.
Subventionsbetrug unterliegt den Regelungen des § 264 StGB, wobei zwischen leichten und schweren Fällen unterschieden wird. Als leichte Fälle gelten unter anderem Täuschungen oder falsche Tatsachen, während schwere Fälle groben Eigennutz, gefälschte Belege und größeren Betrug umfassen. Bereits bei der Antragstellung kann es zu strafrechtlichen Konsequenzen kommen, unabhängig von einer Genehmigung oder Auszahlung der Hilfen.



