Der Wolf in Niedersachsen: Ein Streitthema zwischen Bauern und Politik!
Der Artikel beleuchtet die Rückkehr des Wolves in Vechta seit 2014, dokumentiert Schäden an Nutztieren und politische Forderungen zur Wolfsregulierung.
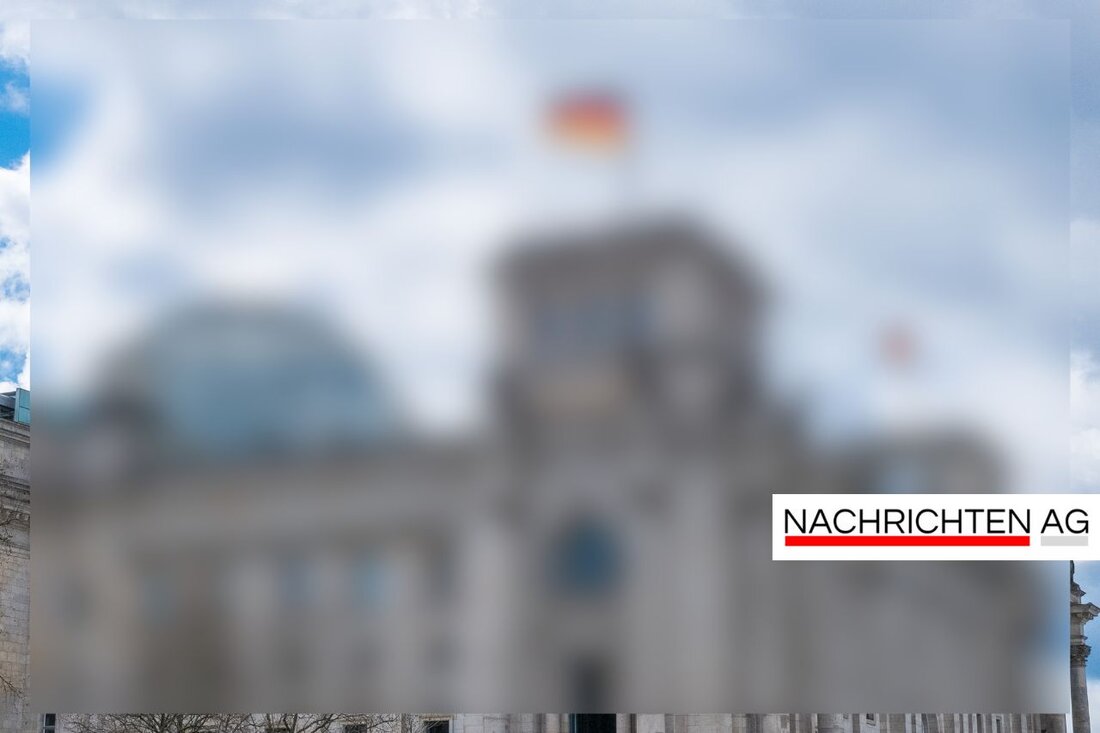
Der Wolf in Niedersachsen: Ein Streitthema zwischen Bauern und Politik!
Der Wolf ist seit seiner Wiedereinwanderung in den Nordwesten Deutschlands ein brisantes Thema, das die Gemüter erhitzt. Wer hätte gedacht, dass die Rückkehr eines Tieres, das seit über hundert Jahren als ausgestorben galt, so viele Kontroversen auslösen würde? Bereits Ende 2014 tauchte der Wolf in der Region auf, was auf einem Biohof in Großenkneten dokumentiert wurde. Seither ging es turbulent weiter: zahlreiche Sichtungen und Risse von Nutzieren ereigneten sich in den Landkreisen Oldenburg, Vechta und Cloppenburg. So wurden allein zwischen Dezember 2014 und Februar 2015 fast 60 Nutztiere im Landkreis Vechta gerissen, darunter Berichte über einen „Goldenstedter Problem-Wolf“ im Herbst 2015.
Auch in den Folgejahren blieb die Situation angespannt. 2017 wurden die ersten Wolfsangriffe in Friesland und Wesermarsch gemeldet, und im Ammerland tauchte ein Wolf auf, während ein anderer im Oktober 2017 illegal erschossen wurde. Sogar auf einen ausgestopften Wolf wurde aufmerksam gemacht, der 2018 für Aufseher sorgte. Doch die Wölfe waren nicht untätig; von 2019 bis 2025 wurde in mehreren Landkreisen ein Anstieg der Risse dokumentiert, was die Landwirte stark unter Druck setzte. Die Tierschützer und die Landwirtschaft fanden sich in einem endlosen Konflikt wieder, der nicht zuletzt auch durch die steigenden Besucherzahlen an den Wolfssichtungsorten befeuert wurde.
Der Druck auf die Politik wächst
Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Wolfsrisszahlen und den anhaltenden Protesten der Bauern fordern nun auch Verbände wie der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Deutsche Jagdverband (DJV) eine Kehrtwende in der Wolfspolitik der Bundesregierung. Anlässlich des „Tag des Wolfes“ am 30. April 2025 appellierten sie an die Regierung, ein wirksames Wolfsmanagement zu implementieren und die bestehenden Spielräume zur Regulierung des Wolfsbestandes zu nutzen. Bernhard Krüsken vom DBV kritisiert die hohe Wolfsbesatzdichte in Deutschland, die sich auf etwa 3.000 Tiere beläuft, und berichtet von jährlich 6.000 gerissenen Nutztieren.
Krusken sieht den Erhaltungszustand des Wolfes als erreicht an und fordert eine amtliche Feststellung, die eine Änderung des Schutzstatus in der FFH-Richtlinie nach sich ziehen sollte. Auch Helmut Dammann-Tamke vom DJV unterstützt diese Auffassung und verlangt eine Rückstufung des Wolfes auf EU-Ebene sowie ein schnelles Interventionsmanagement bei Nutztierrissen. Ein weiterer zentraler Punkt des Appells ist die Forderung nach einem Sofortprogramm zum Schutz der Weidetierhaltung, was bei den betroffenen Tierhaltern auf viel Zustimmung stößt.
Fehlendes Vertrauen in Herdenschutzmaßnahmen
Laut Dr. Kay Ruge vom Deutschen Landkreistag (DLT) ist das bisherige Management stark unzureichend. Er sieht die sinkende Akzeptanz für den Wolf gerade in Ostdeutschland und betont, dass die Öffentlichkeit mehr über die Probleme der Landwirtschaft mit den Wölfen informiert werden müsse. Jens Schreinecke, ein Tierhalter aus Brandenburg, schilderte zudem, dass trotz umgesetzter Herdenschutzmaßnahmen zahlreiche Probleme bestehen bleiben und forderte verstärkt aktiven Herdenschutz.
Die Fronten zwischen Landwirten, Jägern und Kommune scheinen verhärtet, doch alle Seiten wissen: Wenn nichts unternommen wird, könnte die Kluft zwischen Tier- und Naturschutz auf der einen und den Erfordernissen der Landwirtschaft auf der anderen Seite tiefer werden. Der DBV spricht von politischem Widerstand gegen eine Regulierung und fordert eine Obergrenze von etwa 1.000 Wölfen pro Population.
Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung scheint gemacht: Mit der neu eingeführten Richtlinie „SchaNa“, die Herdenschutzmaßnahmen fördert, hoffen viele auf eine Entspannung der Lage. Allerdings stößt diese Regelung auf gemischte Reaktionen seitens der Landwirte, die sich weiterhin nach einem verlässlichen Konzept sehen, um die Produktion und die Weidetierhaltung zu sichern. Es bleibt abzuwarten, ob die verantwortlichen Politiker der Herausforderung gewachsen sind und ob ein gemeinsamer Weg, der nicht nur die Wölfe, sondern auch die Interessen der Landwirte berücksichtigt, eingeschlagen werden kann.
Für die Zukunft wird klar: um die Akzeptanz für den Wolf in der Bevölkerung zu steigern, kann nur ein transparentes und aktives Management helfen, das sowohl der Natur als auch den landwirtschaftlichen Bedürfnissen gerecht wird. Bleibt zu hoffen, dass es bald zu einem Dialog kommt, der das überfällige Verständnis für die komplementären Herausforderungen von Naturschutz und Landwirtschaft fördert, sodass alle Beteiligten eine Lösung finden können.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto