EU-Kommissarin Roswall besucht Niedersachsen: Moor- und Vogelschutz im Fokus!
EU-Kommissarin Roswall besuchte Niedersachsen, um innovative Projekte zum Moor- und Wiesenvogelschutz zu unterstützen und zu fördern.
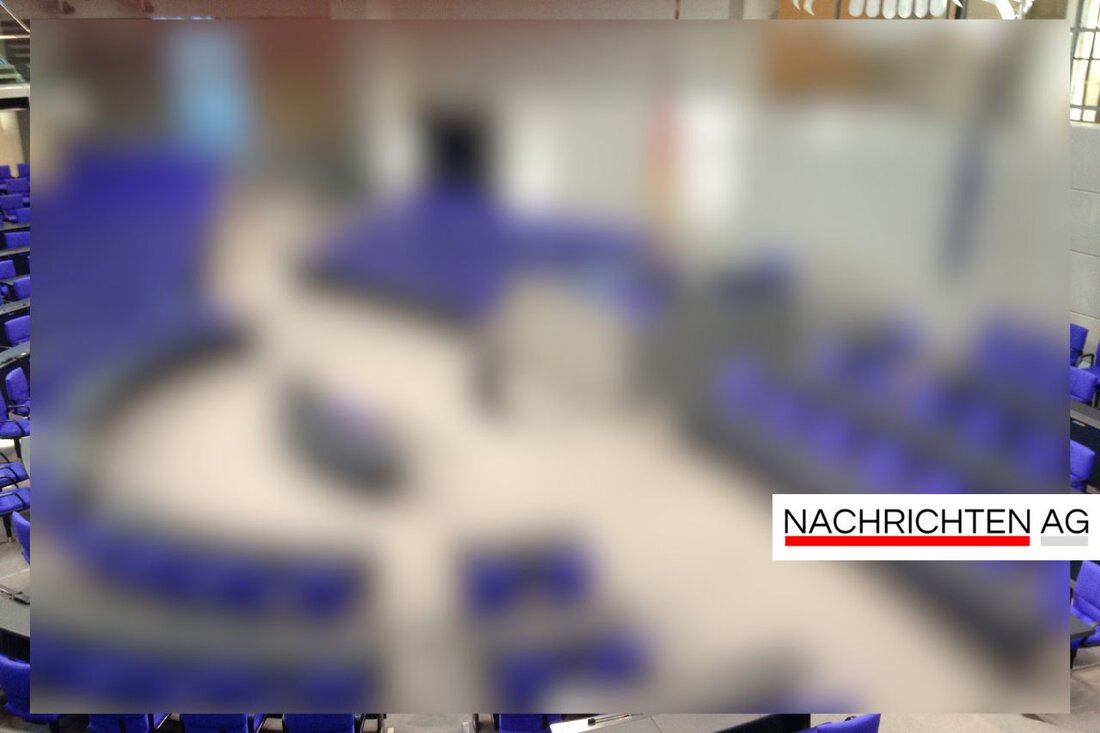
EU-Kommissarin Roswall besucht Niedersachsen: Moor- und Vogelschutz im Fokus!
Am 17. November 2025 besuchte die EU-Kommissarin für Umwelt, Wasserresilienz und Kreislaufwirtschaft, Jessika Roswall, die Regionen Niedersachsen und Bremen. Der Fokus ihres Besuchs lag auf dem Schutz von Wiesenvögeln und Mooren. Bei leicht regnerischem Wetter ließ sie sich über das Projekt „GreenMoor II“ im Bremer Blockland und das „nasse Dreieck“ informieren. Begleitet wurde Roswall von Jan Ceyssens, dem stellvertretenden Kabinettschef, sowie den Europaabgeordneten Lena Düpont, David McAllister und Stefan Köhler.
Während des Besuchs erklärte Lena Hauschildt vom Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen, wie Emissionen bei verschiedenen Wasserständen gemessen werden. Landvolkpräsident Dr. Holger Hennies äußerte sich optimistisch über die Gespräche, die gemeinsam mit dem Bremischen Landwirtschaftsverband organisiert wurden. Im Rahmen des Tages wurden verschiedene Themen angesprochen, darunter die erneute Zusage zur Wasserstandsregulierung und die Wiederherstellung von Mooren, die entscheidend zur Minderung von Treibhausgasen durch Dauergrünland beitragen.
Kooperation für den Naturschutz
„Kooperation statt Regulation“ lautete das Motto des Tages. Hennies betonte, dass positive Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik unerlässlich sei. Auch die Schwierigkeiten durch Düngeregelungen in „Roten Gebieten“ wurden angesprochen, die zu einer Unterversorgung der Pflanzen führen. Kritisch äußerte er sich zu kollektiven Bestrafungen ohne das Verursacherprinzip. An diesem Tag wurden Impulsvorträge zur Wasserschutzgebietsberatung und zur Nährstoffsituation in Niedersachsen und Deutschland gehalten, die Anknüpfungspunkte für eine Verbesserung der Situation bieten sollen.
Die Notwendigkeit, Moorböden zu schützen, wird auch im Bundes-Klimaschutzgesetz klar umrissen. Diese Böden, die etwa 8% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ausmachen, sind bedeutende Kohlenstoffsenken und spielen eine entscheidende Rolle im Wasserkreislauf. Jährlich fallen ungefähr 53 Millionen Tonnen CO2-Emissionen an, die aus der Zersetzung von entwässerten Moorböden resultieren. Daher hat die Bundesregierung die Nationale Moorschutzstrategie initiiert, welche eine jährliche Reduktion der Treibhausgasemissionen um 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bis 2030 zum Ziel hat. Dabei stehen Wiedervernässungsmaßnahmen im Fokus, um die Emissionsbilanz zu verbessern und intakte Moore als naturnahe Ressourcen zu fördern.
Innovative Lösungsansätze
Ein zukunftsorientierter Ansatz ist die Paludikultur, bei der nasse Moorflächen nachhaltig genutzt werden. Hierzu gehören beispielsweise der Anbau von Rohrkolben und Torfmoos sowie die Haltung von Wasserbüffeln. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert solche Nutzungsmöglichkeiten mit einem Betrag von etwa 80 Millionen Euro bis 2032. Dabei wird die Umstellung auf neue Anbaumethoden für die Landwirte zur Herausforderung, da dafür oft neue Maschinen und Vertriebswege notwendig sind.
Im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 erhielt auch die Agrophotovoltaik Unterstützung, die eine Kombination von Photovoltaikanlagen und landwirtschaftlicher Nutzung darstellt. Dieser innovative Ansatz soll zukünftig ebenfalls auf wiedervernässten Moorböden gefördert werden. Eine aktuelle Untersuchung der Universität Greifswald wird die Auswirkungen von PV-Anlagen auf Moorböden erforschen und so zur Weiterentwicklung nachhaltiger Praktiken im Agrarsektor beitragen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass der Tag nicht nur wichtige Impulse für den Moorschutz setzte, sondern auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren im Bereich Landwirtschaft und Naturschutz herausstellte. Entsprechend sind zukunftsorientierte Konzepte gefragt, die sowohl den Klimaschutz unterstützen als auch den Landwirten Perspektiven bieten.
Weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen im Moorbodenschutz finden Sie unter Landvolk, BMELH und Landwirtschaft.de.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto