Schockierende Ausstellungen in Rostock: Misshandlungen von DDR-Kindern enthüllt!
Entdecken Sie die Wanderausstellungen in Rostock über Misshandlungen in DDR-Heimen, die bis zum 22. August zu sehen sind.
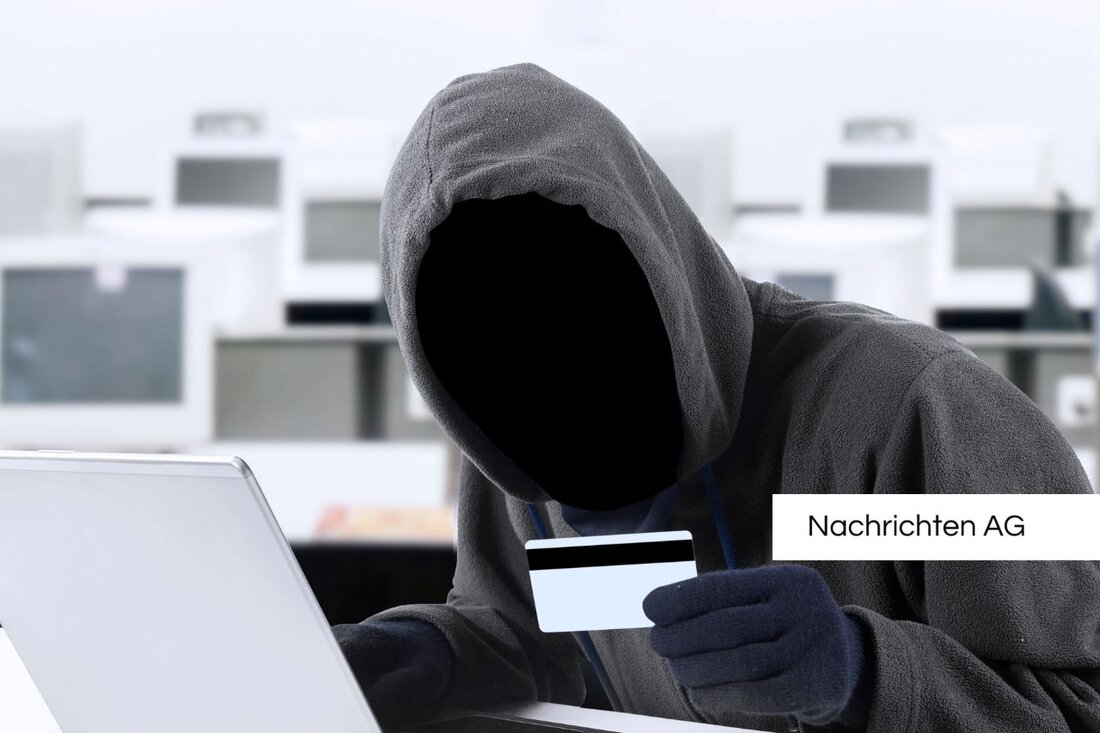
Schockierende Ausstellungen in Rostock: Misshandlungen von DDR-Kindern enthüllt!
In der Rostocker Dokumentations- und Gedenkstätte wird derzeit auf schmerzhafte Kapitel der Vergangenheit aufmerksam gemacht. Zwei Wanderausstellungen, die unter dem Titel „Einweisungsgrund: Herumtreiberei“ und „Blackbox Heimerziehung“ laufen, thematisieren die schweren Misshandlungen von Kindern in der DDR. Laut NDR haben insgesamt über 135.000 Kinder und Jugendliche in sogenannten „Spezialkinderheimen“ und geschlossenen Einrichtungen wie den Venerologischen Stationen ihr Leben verbracht. Diese Einrichtungen sollten den Heranwachsenden nicht nur eine sozialistische Erziehung bieten, sondern häufig gingen sie auch mit extremer Gewalt einher.
Besonders verstörend ist die Geschichte von Jana Mendes Bogas, einer Zeitzeugin, die ihre Erfahrungen im Kinderheim und den Venerologischen Stationen schildert. Ihre Mutter war aus politischen Gründen inhaftiert, sodass der Kontakt zwischen den beiden unmöglich wurde. Von 1982 bis 1987 lebte Mendes Bogas in mehreren Einrichtungen, unter anderem im Jugendwerkhof in Torgau, wo sie und ihre Altersgenossen körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Die belauernde Atmosphäre und die fehlende Intimsphäre bei medizinischen Untersuchungen in der Venerologischen Station in Leipzig-Thronberg zeigen die Unmenschlichkeit, die oft zum Alltagsbild gehörte.
Die Rolle der Venerologischen Stationen
Die Venerologischen Stationen in der DDR waren speziell dafür eingerichtet worden, um Mädchen und Frauen ab 12 Jahren unter dem Verdacht auf Geschlechtskrankheiten zu behandeln. Ein straffes Regime und die Praxis der Zwangseinweisungen prägten diese Einrichtungen seit den 1960er Jahren. Während in der Bundesrepublik Deutschland geschlossene Stationen nur für Personen mit nachgewiesenen Krankheiten gegründet wurden, genügte in der DDR der bloße Verdacht für eine Einweisung. Diese Zwangsmaßnahme wurde nicht nur durch das Ministerium für Gesundheitswesen koordiniert, sondern auch vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) überwacht, wie bpb verdeutlicht.
In den geschlossenen Stationen fiel der Alltag sehr hart aus: Die Aufenthaltsdauer betrug meist vier bis sechs Wochen, konnte aber im Extremfall bis zu zwölf Wochen andauern. Dabei erhielten viele der Internierten keine angemessene medizinische Betreuung – in einem Fall erhielten rund 70 Prozent der 235 in Halle zwangseingewiesenen Frauen keine Therapie, obwohl ein erheblicher Teil nachweislich infiziert war.
Aufarbeitung und Unterstützung
Trotz der Schwere der Vergehen ist die Aufarbeitung dieser Misshandlungen in den Heimen längst noch nicht abgeschlossen. Viele Betroffene finden es im fortgeschrittenen Alter schwer, über ihre Erfahrungen zu sprechen, was die Aufarbeitung erschwert. Die aktuelle Ausstellung in Rostock hat das Ziel, genau diese Themen öffentlich zu machen und einen Raum für Erinnerung und Dialog zu schaffen. Die Ausstellungen sind bis zum 11. August in Rostock und danach bis zum 22. August im Rostocker Rathaus zu sehen. Interessierte und Betroffene können sich zudem an Beratungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern oder den Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur wenden.
Ein weiteres Zeichen der Erinnerung ist die Möglichkeit für Zwangsausgesiedelte, ab Juli Entschädigungen an der innerdeutschen Grenze zu beantragen. Es bleibt zu hoffen, dass die vorherrschenden Tabus irgendwann gebrochen werden und die Schicksale der Betroffenen in ihrer ganzen Tragweite anerkannt werden – der Weg zur Heilung ist lang, doch jede Aufarbeitung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto